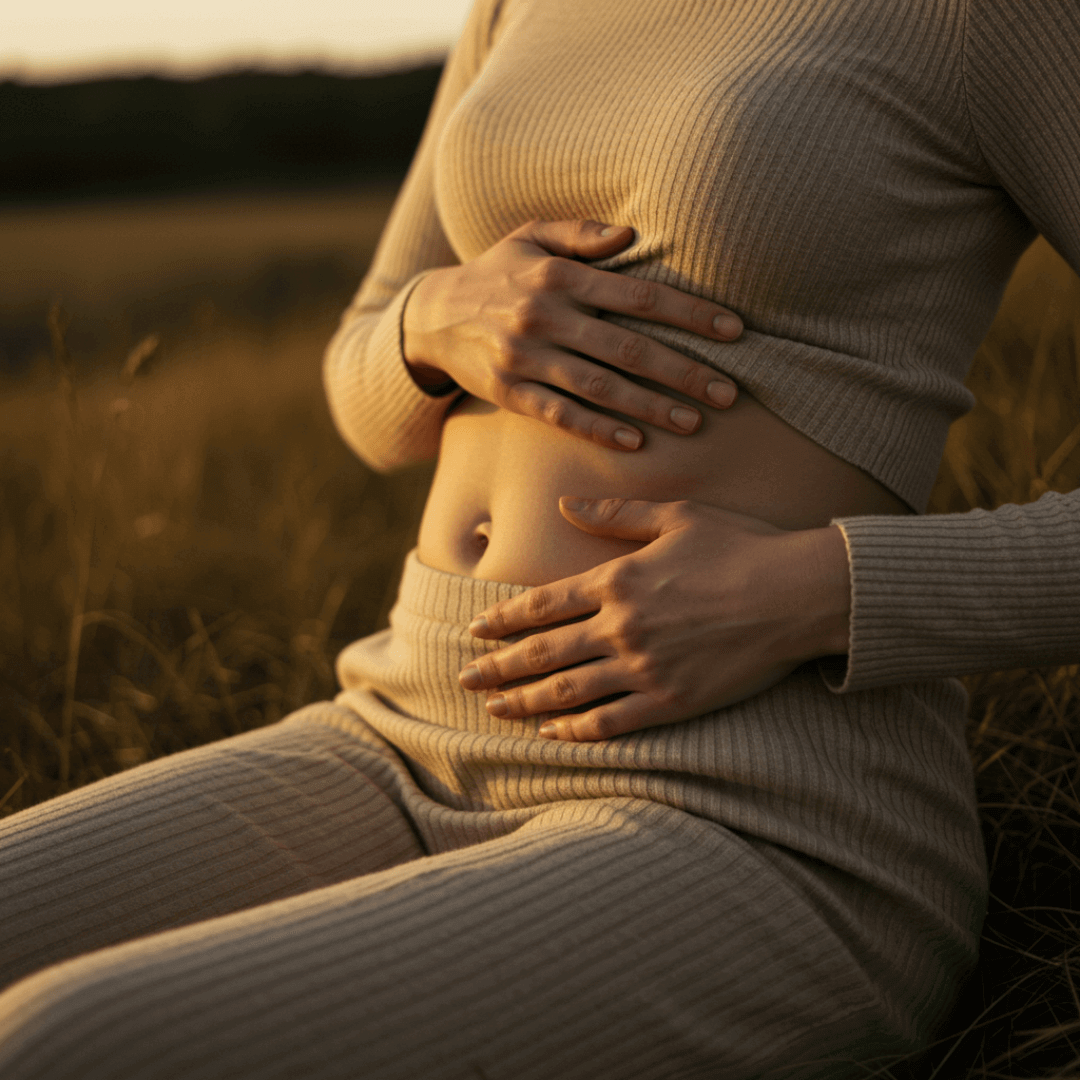Cannabis Clubs ohne Vereinsleben - Wie soll das funktionieren?
Die Deutsche Angst vor innovativer Cannabis-Kultur
Cannabis soll in zwei Schritten legalisiert werden. Der erste, von der Ampel-Koalition „Säule eins“ genannt, sieht vor, Erwachsenen ab 2024 den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis, den Anbau von drei Pflanzen und die Mitgliedschaft in einem Cannabis Club zu gestatten. So ziemlich alles andere, darunter auch eine versteuerte Abgabe über Fachgeschäfte, bleibt bis zur Verabschiedung von Säule zwei illegal. Wann und ob Säule zwei das Parlament passiert, ist noch völlig unklar.
Anders als zum Beispiel in Uruguay oder Spanien sollen die Clubs in Deutschland nicht „social“ sein, also beim soziokulturellen Aspekt im Umgang mit Cannabis außen vor bleiben. Wer mit Freund:innen und Bekannten kiffen will oder einfach nur Infos über Cannabis austauschen möchte, den Umgang mit der Substanz erlernen oder mehr über den Anbau erfahren möchte, soll das, sollte das Gesetz wie derzeit geplant umgesetzt werden, weiterhin im Verborgenen tun.
Alle Vereine sind gesellig, nur Cannabis-Clubs nicht?
Im Vereinsrecht nennt sich der soziokulturelle Aspekt des Vereinslebens „Geselligkeit“. Die ist eine Säule des hiesigen Vereinslebens und soll Cannasseur:innen vorenthalten bleiben. In Spanien, wo ab 2007 die ersten Clubs weltweit entstanden, ist genau dieser soziale Aspekt die rechtliche Grundlage für die Existenz von Cannabis Social Clubs. Nicht die Abgabe gegen einen Unkostenbeitrag steht im Mittelpunkt des Vereinslebens, sondern Anbau und Konsum ohne kommerziellen Hintergrund sowie die Schaffung einer ganzheitlichen Cannabiskultur. Dazu veranstalten die Vereine Anbau-, Präventions- oder auch Extraktions-Seminare und ermöglichen ihren Mitgliedern ganz nebenbei, das selbst ergärtnerte Kraut in den Vereinsräumen zu beziehen und danach gemeinsam zu genießen.
So muss niemand mehr mit seinen Freund:innen im Park oder vor der Kneipe kiffen. Der soziale Aspekt fördert den öffentlichen Konsum nicht zwangsläufig, im Gegenteil. Im Cannabis-Club-Paradies Barcelona wird der öffentliche Konsum von Cannabis mit hohen, dreistelligen Geldbußen geahndet – weil man ja auch in einem Club hätte rauchen oder vaporisieren können. Die Clubs selbst dürfen als solche von außen nicht erkennbar sein. Zudem sind die Betreibenden verpflichtet, mithilfe von professionellen Abluftsystemen die Luft in und besonders vor den Clubräumen rein zu halten. So gut getarnt erfüllen diese nicht sicht- und riechbaren Clubs alle Voraussetzungen für einen funktionierenden Jugendschutz besser als jede Abstandsregel.
Man stelle sich einmal vor, ein Hobbybrauer-Verein dürfe sein Bier brauen und an die Mitglieder verkaufen, aber nicht gemeinsam verkosten. Da würde jedes deutsche Amtsgericht den Vereinszweck infrage stellen. Cannabis-Clubs hingegen sollen nicht wie klassische Vereine, sondern als reine Cannabis-Abgabevereinen agieren.
Fehlende Fachgeschäfte erschweren die geplante Rolle der Clubs
Der DHV Vorsitzende Georg Wurth hat es mit den Worten „Nicht jede:r, die:der Joghurt mag, will eine Kuh“, auf einen einfachen Nenner gebracht.
Cannabis (Social) Clubs sind eine Nische für Cannabis-Enthuisiast:innen und dem Ansturm, der sich schon jetzt abzeichnet, als unkommerzielle Organisation gar nicht gewachsen. Wer nur sporadisch kifft oder seinen Jahresbedarf mit drei Balkon-Pflanzen nicht decken kann, möchte nicht unbedingt an einem Cannabis-Vereinsleben teilnehmen müssen, um Samstag Abend einen Joint vor dem Kinogang zu rauchen.
Die erste Phase der Legalisierung berücksichtigt demnach lediglich Enthusiast:innen, die ihre Freizeit dem Anbau und/oder dem Vereinsleben widmen. Wer schnell und unkompliziert mal einen Joint rauchen möchte, hat weiterhin ein Problem. Gleichzeitig ist es Privatpersonen gestattet, bis zu 25 g Cannabis und drei Pflanzen zu besitzen. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Fachgeschäfte geben wird, werden die, die weder Clubmitglied sein noch Weed anbauen möchten, ihr Cannabis, wie all die Jahre zuvor, illegal beziehen. Die, die es verkaufen, werden aber noch schwerer zu fassen sein als zu Zeiten des Verbots. Denn weder der Besitz von bis zu 25 g noch der Geruch nach Cannabis dürfen dann als Rechtfertigung repressiver Maßnahmen wie Hausdurchsuchungen oder Personenkontrollen dienen. Zudem sinkt die Hemmschwelle der Konsumierenden, weil ihr Handeln nicht mehr strafbar ist. Wenn der Gesetzgeber denkt, die entstehende Lücke werde nicht ausgenutzt, hilft ein Blick nach Nevada. Erst als Dealer offen mit gefüllten Grasbeuteln vor den Casinos standen, gab es Lizenzen für Shops im Touristenviertel “The Strip”. Bis dahin dachte man ernsthaft, man könne Cannabis nur für Einheimische legalisieren, indem man in der Nähe von touristischen Hotspots keine Fachgeschäfte zulässt. Das ist ebenso utopisch wie die Vorstellung, man könne den Schwarzmarkt ganz ohne Fachgeschäfte kleinkriegen.
Clubs für alle?
Natürlich bestünde die Möglichkeit, dass Clubs auch Menschen mitversorgen, die bei freier Wahl lieber ins Fachgeschäft gehen würden. Das wiederum gefährdet allein aufgrund der Menge den unkommerziellen Charakter der Clubs, der von der Regierung ausdrücklich angestrebt wird und der das Vereinsleben in Deutschland auch grundsätzlich auszeichnet. Wenn alle fünf bis acht Millionen Kiffer:innen ihr Weed legal über einen Verein bezögen, bräuchten wir über kurz oder lang 10.000 + x große (500 Mitglieder) Cannabis Clubs. Clubs in Spanien sollten gemäß eines Urteils des Obersten Gerichts übrigens nicht mehr als 300 Mitglieder haben, um eben diesen unkommerziellen Charakter zu bewahren.
Egal, von welcher Seite aus man es betrachtet: ohne zeitgleich oder wenigstens zeitnah Fachgeschäft-Projekte zu ermöglichen, scheint die Regierung den Missbrauch der grundsätzlich überfälligen Entkriminalisierung wissend in Kauf zu nehmen. Je länger diese tolerierte Grauzone besteht, umso stabilere Strukturen bilden sich in ihr aus. Als bestes Beispiel dienen hier die Coffeeshops in den Niederlanden oder auch die Vergabe der Cannabis Social Club-Lizenzen in und um Barcelona. Besonders in den Niederlanden haben sich auf dem Cannabis-Schwarzmarkt hochkriminelle Strukturen etabliert, weil Handel und Weitergabe von Kleinstmengen seit 50 Jahren entkriminalisiert, Produktion und Großhandel aber illegal sind und seit einigen Jahren oft sogar härter als hierzulande bestraft werden.
Deutschland plant zwar keine Coffeeshops, aber im Grunde genommen ein ähnliches Konstrukt: Im Kleinen ist es legal, aber der Großhandel bleibt tabu. Je länger dieser Zustand bestehen bleibt, desto schwerer wird es, den jetzt schon unüberschaubaren Schwarzmarkt später wirklich durch eine kontrollierte Lieferkette zu ersetzen.
Ein Blick über den Tellerrand hilft
Anders als der Gesetzentwurf in Deutschland wurde der Schweizer Experimentierartikel, der als Grundlage für die dortigen Cannabis-Pilotversuche dient, nicht mit der heißen Nadel gestrickt. Hier hat sich das Bundesamt für Gesundheit viel Zeit genommen und zwei grundlegende Fehler vermieden:
- Cannabis SOCIAL Clubs dürfen dort auch soziokulturelle Aufgaben wahrnehmen
- Neben Clubs dürfen auch Fachgeschäfte und Apotheken Cannabis im Rahmen der Pilotprojekte abgeben.
So können unsere Nachbarn nach der fünfjährigen Pilotphase entscheiden, welches Abgabe-Modell funktioniert. Konsumierende haben zudem einen Ort, sich abseits öffentlicher Räume oder Grünflächen zu treffen und auszutauschen. Wissenschaftliche Forschung zum Umgang mit Weed wird dort in Form eines Arbeitsmoduls zur Konsumkompetenz erst durch die Social-Club-Mitglieder möglich. In Deutschland will man wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, indem man den Clubs eine gesellschaftlich notwendige Funktion nicht zutraut und sie zu reinen Cannabis-Anbau- und Abgabestellen degradiert. Genau diese Art der Zwangs-Kommerzialisierung lädt zum Missbrauch ein. Hier sind nicht die Niederlande, sondern die Clubs in Barcelona, von denen ein Großteil wie Coffeeshops agiert, als Beispiel für die Fehlinterpretation des ursprünglichen Club-Gedankens anzuführen. Diese Art von Missbrauch der lokalen Cannabis-Gesetze wiederum ist jedoch nicht Schuld der Betreiber, sondern das Ergebnis einer 15 Jahre geduldeten Grauzone, die aufgrund des rechtlichen Status von Cannabis in Spanien immer noch keine Fachgeschäfte zulässt.
In weniger liberalen Landstrichen von Spanien werden Clubs übrigens bis heute strenger von den Behörden und der Polizei kontrolliert als an den cannafinen Hotspots wie Katalonien oder den Kanaren. So gibt es in Madrid oder Valencia zwar auch Cannabis-Clubs, die Touristen jedoch verschlossen bleiben. Solche Clubs haben selten mehr als 300 Mitglieder und dienen der lokalen Bevölkerung als Weed-Quelle für den Feierabend-Joint ohne weitere Verpflichtungen. Wer Interesse hat, kann – muss aber nicht – beim Anbau helfen.
In den großen Clubs der katalanischen Metropole bauen die Mitglieder schon seit 2019 gar nicht mehr selbst an, sondern lassen ihr Gras von professionellen Gärtner:innen produzieren. Das entspricht eigentlich nicht den Vorgaben für Social Clubs, wird aber von der Lokalregierung toleriert. Ohnehin hat man in Barcelona das Gefühl, die lokale Cannabis-Politik habe auch etwas mit dem Konflikt um die katalanische Unabhängigkeit zu tun. Denn die Zentralregierung hat dort ganz andere Probleme als ein paar Social Clubs, die nicht nach den Vorstellungen und Gesetzen der Zentralregierung in Madrid, sondern gemäß eines Beschlusses der Lokalregierung wie Shops agieren.
Clubs, die, wie von der Regierung in Spanien oder bald auch in Deutschland gewünscht, unkommerziell agieren, dürfen aber über eines nicht hinwegtäuschen: Der Schwarzmarkt blüht auch in Spanien weiter im Verborgenen. Nur in Barcelona, wo Clubs aufgrund der lokalen Gesetzgebung im Prinzip wie 18+ Fachgeschäfte agieren können, sind die Dealer, die einst die Ramblas bevölkerten, ganz verschwunden. Im Rest des Landes existieren Cannabis-Clubs und Schwarzmarkt nebeneinander her. Während die vielen Gelegenheitskiffer:innen und Tourist:innen in einer durchschnittlichen spanischen Stadt auf dem omnipräsenten Schwarzmarkt kaufen, treffen sich eingefleischte Cannasseur:innen und mangels Gesetz auch Patient:innen in den örtlichen Cannabis-Clubs.
Der perfekte Club…
… kann eigentlich nur parallel zu Cannabis-Fachgeschäften für Erwachsene existieren. Nur so ist eine Kommerzialisierung, ob von den Betreibenden gewollt oder nicht, aus oben angeführten Gründen vermeidbar. Außerdem sollte er andere Aufgaben, als dem Gesetzgeber derzeit vorschweben, erfüllen:
- Der Anbau sollte erfahrenen Mitgliedern überlassen werden, die dazu auch Lust und Zeit haben und nicht, wie aktuell geplant, obligatorisch für alle sein. Ähnlich wie in anderen Vereinen mit einer Verpflichtung zur Mitarbeit, könnten solche Pflichten auch durch andere Tätigkeiten für den Verein oder eine finanzielle Kompensation beglichen werden.
- Um das Vereinsleben auszugestalten, sollte der Verein Aufklärungsarbeit zu Cannabis leisten. Hier stehen Konsumkompetenz sowie das Vermitteln schadstoffarmer Konsumformen im Fokus. Ähnlich wie ein Obst- und Gartenbauverein kann auch Wissen über den Anbau, Ernte und Veredelung in Form von theoretischen und praktischen Fortbildungsveranstaltungen stattfinden. Besonders die Produktveredelung, also im Falle von Cannabis die Extraktion, sollte nicht grundsätzlich verboten, sondern, ähnlich wie die Herstellung von Obstwein im Obst- und Gartenbauverein, Teil der Club-Kultur sein. Dabei könnte Colorado als Beispiel dienen. Dort ist es Privatpersonen gestattet, Extrakte mit Hilfe nicht explosiver Lösungsmittel wie Alkohol oder einer mechanischen Presse zu extrahieren. Gefährlichere Extraktionsmethoden mit explosiven Lösungsmitteln, wie zum Beispiel Butan, dürfen hingegen nur von lizenzierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
- Die geplante Abstandsregel zu Schulen sollte durch eine obligatorische Kooperation mit den Schulsozialstationen und/oder der Schulleitung ersetzt werden. Grundsätzlich stellt sich hier die Frage: Wie soll ein von außen nicht wahrnehmbarer Vereinsraum das Konsumverhalten minderjähriger Schüler:innen beeinflussen, die nicht mal in die Vereinsräume schauen, geschweige denn Mitglied werden dürfen? Zudem schafft ein persönlicher Kontakt zu den Schulen ein Vertrauensverhältnis und könnte zukünftig auch als Vorbild für schulnahe Kneipen dienen.
- Mehrfachmitgliedschaften sollten möglich sein. Sie fördern den Wissensaustausch und erhöhen die legale Besitzmenge nicht.
- Clubs sollten die Möglichkeit haben, überschüssiges Cannabis aus Privatanbau zu testen und, so es denn sauber ist, anzukaufen. So wird es für Privatpersonen unattraktiv, überschüssiges Cannabis aus dem legalen Eigenanbau auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ähnlich wie die jährlichen 200 Liter beim Brauen von Bier wäre nur eine für den eigenen Bedarf definierte Menge steuerfrei. Wer zuhause sauberes Weed anbaut, könnte sich sogar ein legales Zubrot verdienen und den Schwarzmarkt im Sinne der Behörden aktiv bekämpfen.
- Für eventuell anzustellendes Personal sollte ausschließlich das Vereinsrecht gelten. Sonderregeln wie die geplante Schaffung prekärer Arbeitsverhältnisse beim Cannabis-Anbau haben im Verein nichts zu suchen.
- Beschränkungen für Saatgut und Stecklinge sollten komplett wegfallen.
- Die Mitgliederzahl sollte nur dann begrenzt werden, wenn die Hürden zum Betrieb eines Clubs nicht so hoch wie derzeit geplant sind. Was hilft es, wenn ein Club statistisch 5000 Personen versorgen muss, aber nur 500 versorgen darf – oder auch umgekehrt? Wer profitiert, wenn die 4500, die nicht mehr in den Club kommen, trotz Entkriminalisierung schwarz einkaufen?
Clubs sind nicht für jede:n was
Die ursprüngliche Idee von Cannabis-Clubs war es, kleinen Grower:innen und Kiffer:innen eine Möglichkeit zu geben, ihr Gras für den eigenen Bedarf straffrei anbauen, besitzen und im Freundeskreis genießen zu dürfen. Durch den eigenen, teilweise ehrenamtlichen Anbau und die ausschließliche Abgabe an Mitglieder, ein Werbeverbot für Clubs oder ihr Produkt unterliegt von Clubs angebautes Cannabis nicht den Mechanismen des Freien Marktes. Ähnlich wie die im Obst- und Gartenbauverein angebauten Äpfel erhalten Club-Mitglieder die Früchte ihrer Arbeit deshalb zu anderen Konditionen, als die Kund:innen eines Obstladens. Wäre ja auch unlogisch, wenn man zur Pflege seines Hobbys extra einem Verein beitritt, der am Ende nur Geld und Aufwand, aber keinerlei Vorteile mit sich bringt. Deshalb ist das selbst ergärtnerte Gras in den Clubs ohne Touristen-Zugang in Spanien für die Mitglieder meistens auch viel günstiger als das in niederländischen Coffeeshops oder den Touristen-freundlichen Clubs Barcelonas.
Deshalb sind Cannabis (Social) Clubs für “cannaffine” Zeitgenossen und Zeitgenossinnen gemacht, die sich einer jetzt zu schaffenden Cannabis-Kultur widmen wollen. Wer keinen Bock hat, Cannabis-Kulturschaffende:r zu werden, wäre im Fachgeschäft eigentlich weitaus besser aufgehoben – wenn das denn möglich wäre. Doch so heißt es wohl auch für Quartals- und Gelegenheitskiffer:innen ab 2024: Willkommen im Club! Wer darauf keine Lust oder zu wenig Zeit für das Formale hat, darf auch 25 g besitzen – und das mangels Fachgeschäften ganz ohne Herkunftsnachweis. Ein Dach mit nur einer Säule ist eben nicht belastbar und kippt sofort. Deshalb könnte, falls die Säule zwei nicht sehr zeitnah verabschiedet wird, die tragende Rolle der zweiten Säule bis auf Weiteres von einem Schwarzmarkt mit viel weniger Hemmungen als momentan ersetzt werden.
Hinweis: Grundsätzlich spiegeln namentlich gekennzeichnete Beiträge nicht immer die Positionen von avaay und/oder der Sanity Group wider, sondern sind Ausdruck der pluralistischen Perspektiven und Ansätze der Autor:innen im Rahmen einer modernen Cannabis-(Drogen)-Politik/Thematik.