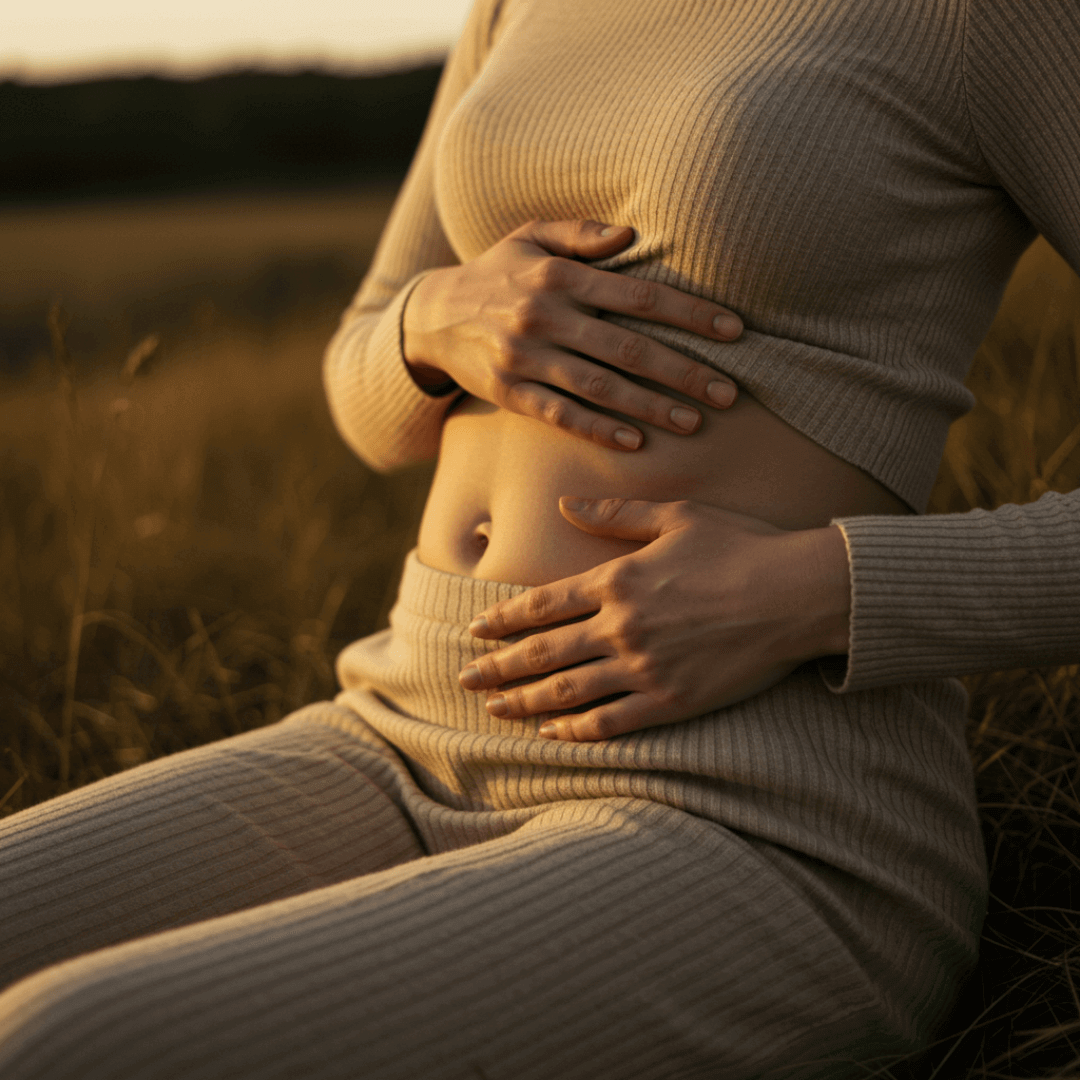Cannabis kommt nicht vom Klapperstorch
Wie ich meinem Kind erkläre, dass ich Cannabis konsumiere
Seit der Teil-Legalisierung von Cannabis könnten Eltern viel sorgenfreier mit ihren Kindern über ihren eigenen Konsum reden – sofern sie es möchten. Die Frage ist nur: Wie? Neben den richtigen Tipps brauchen Eltern eigentlich einen Ausdruck des KCanG (Konsumcannabisgesetz), um im Rahmen einer zeitgemäßen und somit Konsum akzeptierenden Aufklärung nicht gegen das neue Gesetz zu verstoßen.
Die Zeiten ändern sich
Als Kind der 1970er Jahre bin ich mit Kinderbowle, Schokoladenzigaretten und Apfelschnaps-Bonbons groß geworden. Damals hat sich kaum jemand Gedanken darüber gemacht, dass ein allzu sorgloser Umgang mit legalen Substanzen den Nachwuchs eventuell zu deren späterem Missbrauch animieren könnte. Zu Silvester durfte man sogar mit einem Schlückchen echten Sekt, gemischt mit O-Saft, anstoßen oder auch mal eine Schnaps getränkte Erdbeere aus der damals auf jeder Party obligatorischen Bowle naschen. Der Geruch von kalten Kippen und verqualmte Räume waren für uns Kinder damals so alltäglich wie Schlaghosen und Toast-Hawaii. Über die Folgeschäden des Aktiv- und Passivrauchens machten die Erwachsenen allenfalls schlechte Witze, über die heute keiner mehr lachen würde. Kurzum, damals mussten Eltern ihre Laster und Abhängigkeiten nicht vor dem Nachwuchs verbergen, im Gegenteil: Man wurde schon früh darauf vorbereitet, welche Substanzen zum Alltag der Erwachsenenwelt gehören, wobei für illegale Substanzen dabei natürlich kein Platz war.
Zwar gehen wir mit Kaugummizigaretten, Kinderbier und Weckmann-Pfeifen heutzutage ein wenig kritischer um, aber Alkohol ist in Sachen Jugendschutz immer noch weitaus laxer reguliert als Cannabis. Ein von der ehemaligen Gesundheitsministerin Künast geplantes Gesetzesvorhaben, die Kinderzigaretten verbieten wollte, wurde bis heute nie umgesetzt, Traubensaft heißt bei edlen Winzern nicht selten Kinderwein. Doch trotz der legalen Verfügbarkeit von Nikotin sinkt der Anteil jugendlicher Raucher:innen dank einer guten Präventionskampagne und Werbeverboten auch ohne neue Verbote seit Jahren.
Neben der öffentlichen Aufklärung hat die Vorbildfunktion der Eltern den entscheidenden Einfluss auf das, was sich die nächste Generation später mal konsumiert. Bei Alkohol können Mütter und Väter den Nachwuchs zu gegebener Zeit an eigenen Konsumerlebnissen teilhaben lassen: Mit 14 Jahren dürfen Jugendliche unter Aufsicht ihrer Eltern alkoholische Getränke wie Bier oder Wein probieren. Der Gedanke hinter dem „begleitenden Konsum“ ist, dass unproblematischer Alkoholkonsum von den Eltern gelehrt und von den Jugendlichen gelernt wird. Bei Cannabis bleibt diese Art der Konsumbegleitung weiterhin verboten.
Vertuschen funktioniert nicht
Cannabis-Patient:innen mit Kindern haben es da noch am einfachsten, weil man selbst den Kleinsten erklären kann, dass Papas oder Mamas Medizin aus der Apotheke kommt und nicht in Kinderhände gehört.
Wie aber erklären verantwortungsbewusste Eltern dem eigenen Nachwuchs, dass sie nach Feierabend ab und an Cannabis konsumieren? Schließlich ist es nicht mehr verboten. Ist man dann ein schlechtes Vorbild oder animiert so sein Kind gar zum Kiffen? Sollten Eltern lieber heimlich konsumieren, selbst wenn es jetzt legal ist? Gesellschaftliche Erfahrungswerte wie beim Alkohol gibt es kaum, weil sich unsere Eltern und Großeltern nie ernsthaft mit Cannabis auseinandergesetzt hatten: Als die Hanfpflanze Ende der 1960er und in den 1970er Jahre eine Renaissance feierte, war Cannabis Teil der 68er Jugend- und Studentenbewegung. Hippies fanden Hanf prima, alle anderen fanden Kiffen doof. Jetzt, wo die zweite und dritte Generation Cannabis als Genussmittel oder als Medizin konsumiert und der Besitz teil-legalisiert ist, gibt es aber immer mehr cannafine Eltern (Eltern mit Cannabiserfahrung) – und damit auch viele Kinder, die Fragen stellen.
Beim Freizeitkonsum aber haben viele Eltern ein Problem, gegenüber dem eigenen Nachwuchs ehrlich zu sein. Immerhin ist Gras nur halb legal und trotz neuer Gesetzeslage noch immer gesellschaftlich stigmatisiert. Sollte man mit den eigenen Kindern überhaupt über den eigenen Konsum reden, oder lügt man sie besser an, um kein schlechtes Vorbild zu sein?
Geht es um die Drogenmündigkeit des eigenen Nachwuchses, sind Lügen und ausweichende Antworten die schlechteste aller Optionen. Wer meint, das Vertuschen des Feierabend-Joints funktioniere, macht sich meistens was vor. Die konischen Zigaretten mit Kräutertabak, lange Papers oder Pfeifen werfen selbst dann Fragen auf, wenn man denkt, sie kindersicher versteckt und immer nur klammheimlich oder mehrere Stunden nach dem Sandmännchen konsumiert zu haben. Ist man dann irgendwann selbst als Lügner oder Heuchler enttarnt, wird es umso schwerer, den gewünschten Einfluss auf die ersten Erfahrungen der Kinder zu nehmen.
Selbstkritik als Referenz
Einem Kleinkind kann man noch erklären, dass Zigaretten giftig und nur für Erwachsene seien. Aber welcher Raucher gesteht der 12-jährigen Tochter oder dem 14-jährigen Sohn ein paar Jahre später, stark nikotinabhängig zu sein? Welcher Bierliebhaber erzählt seinem Nachwuchs schon, dass Alkoholmissbrauch ähnliche Folgen wie der Konsum harter Drogen haben kann?
Kurzum: Problematische Konsummuster oder auch Substanzmissbrauch werden zu selten am eigenen, oft nicht ganz vorbildhaften Verhalten erläutert. Dazu gehören eben aber auch das Feierabend-Bier, die Zigarette nach dem Essen oder der gelegentliche Feierabend-Joint auf dem Balkon. Wer nur heimlich konsumiert, wird trotzdem eines Tages gefragt werden: „Warum rauchst du eigentlich jeden Tag?“
“Weil ich abhängig bin. Ich habe zu früh angefangen und danach schon oft versucht, damit aufzuhören. Aber dann bekomme ich schlechte Laune und schlafe schlecht, bis ich wieder anfange, obwohl das schädlich ist. Das nennt man abhängig, genau gesagt nikotinabhängig.“ Eine solche Antwort fällt vielen schwer, wäre aber ehrlich und für die eigenen Kinder ein anschauliches Beispiel für ein problematisches Konsummuster.
Die Alternative klingt so: „Meine Eltern geben nicht mal zu, dass sie abends heimlich kiffen/rauchen/trinken. Und die wollen mir das verbieten.“ Bevor so etwas passiert, sollte man den inneren Schweinehund einmal überwinden und dem Nachwuchs den eigenen Konsum erläutern – auch wenn die Reflexion des eigenen Konsummusters manchmal schwerfällt.
Selbst Eltern, die nur ab und zu Cannabis konsumieren, sollten ihr unproblematisches Konsummuster vermitteln, bevor es der eigene Nachwuchs eventuell falsch interpretiert und Cannabis für absolut unbedenklich hält. Die Bundesregierung geht auf Grundlage der Capris Studie aus dem Jahr 2021 von 9 % Cannabis-User:innen aus, die problematisch konsumieren. Der Deutsche Hanfverband schreibt, die Art und Weise der statistischen Erfassung der vergangenen Jahre habe mehr Problemkonsumierende erschaffen, als es gäbe. Beim DHV liest man deshalb, es handele sich lediglich um 4-7 % aller Cannabis-Konsumierenden.
Wer diesen Mut nicht hat oder auch um den eigenen Vorbildcharakter fürchtet, muss sich nicht wundern, es mit gleicher Münze heimgezahlt zu bekommen und selbst angelogen zu werden und somit keinen blassen Schimmer zu haben, was sich das eigene Kind “reinzieht”.
Der eigene Konsum, sei er auch noch so moderat, verpflichtet zur lückenlosen Aufklärung über Alkohol und über Cannabis sowie alle anderen Substanzen, die einem heutzutage im Laufe des Lebens so über den Weg laufen werden. Eine von der Substanz unabhängige Drogenaufklärung kann nur wirken, bevor die Probierphase bei den Jugendlichen anfängt.
„Wenn Du kiffst, dann ..….“
Die Androhung repressiver Maßnahmen kann das Konsumverhalten junger Menschen seit 40 Jahren nicht beeinflussen – gleiches im familiären Kreis, um die Neugier der Sprösslinge zu zügeln.
„Wenn ihr schon kiffen müsst, raucht wenigstens nicht“ wird eher als freundschaftlicher Rat wahrgenommen als ein kategorisches „Nein“, ein altbackenes „Trink doch lieber ein Bier“ oder ein ambivalentes „Mach doch, was Du willst“.
Begleitenden Konsum wie bei Alkohol erlauben?
Man kann nicht früh genug damit anfangen, die eigenen Kinder über Cannabis aufzuklären, um spätere Probleme zu vermeiden. Anders verhält es sich jedoch, wenn es ums Probieren geht. Hier ist eine gesetzliche Altersgrenze notwendig, um Jugendliche vor den Folgen eines zu frühen Einstiegs und den damit verbundenen Folgen zu schützen. Der Gesetzgeber sieht hier jedoch vor, dass jedwede Cannabiserfahrung unter 18 Jahren sanktioniert wird. Das ist absolut realitätsfern, da die Probierphase bei Jugendlichen durchschnittlich im 17. Lebensjahr anfängt. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren nicht Konsum akzeptierend beraten zu können, ist – egal, ob im Rahmen einer staatlichen Drogenberatung oder im familiären Kreis – kontraproduktiv. Insbesondere für Eltern, die selbst Erfahrungen mit Cannabis gesammelt haben, ist es kaum nachvollziehbar, dass es keine ähnliche Regelung wie bei Alkohol gibt. Allerdings ist die Regelung für begleitendes Trinken reformbedürftig, 14 Jahre sind definitiv ein zu früher Zeitpunkt – egal, ob für die ersten Alkohol- oder Cannabiserfahrungen. Grundsätzlich wäre die Regulierung von Cannabis ein guter Anlass, den Jugendschutz beim Alkohol etwas strenger zu handhaben und gleichzeitig die Maßnahmen für Cannabis an diese anzulehnen.
Doch bis dahin darf man dem eigenen Nachwuchs nicht vor dem 18. Geburtstag Konsum akzeptierend beraten. Wer es trotzdem tut, verletzt streng genommen seine elterliche Fürsorgepflicht.
Doch selbst wenn begleitendes Kiffen erlaubt wäre, sollten sich betroffene Eltern fragen, ob Mama und/oder Papa das richtige Setting bieten. Man sollte sich bei der geplanten Heldentat vielleicht auch fragen, ob es wirklich geil gewesen wäre, die ersten Munchies und Lachflashs mit den Eltern durchlebt zu haben? In der Regel gilt: Eltern informieren, konsumiert wird in der Clique. Sobald Kontrolle gegenseitigem Vertrauen weicht, kommt der Rest von selbst. Vorher riskiert man, wahlweise als Kiffer-Held, Depp oder hippiesker Hasch-Verherrlicher dazustehen. Nicht der erste gemeinsame Joint, sondern Cannabis-Kompetenz und Authentizität verschaffen Autorität und die damit verbundene Vorbildfunktion als Elternteil. Authentische Eltern, egal ob sie gar nicht, selten oder regelmäßig kiffen, beeinflussen den Probierdrang viel besser als Taschengeldentzug oder der besorgte Drogenfahnder mit Haschklumpen im Schulunterricht.
Hinweis: Grundsätzlich spiegeln namentlich gekennzeichnete Beiträge nicht immer die Positionen von avaay und/oder der Sanity Group wider, sondern sind Ausdruck der pluralistischen Perspektiven und Ansätze der Autor:innen im Rahmen einer modernen Cannabis-(Drogen)-Politik/Thematik